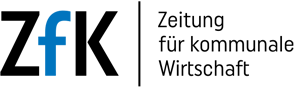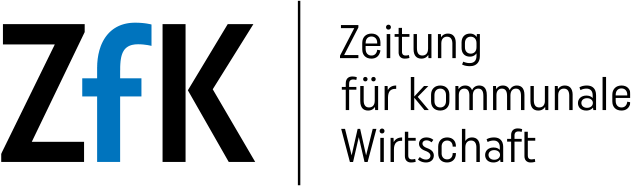Bundeswirtschaftsminister a. D. Werner Müller verstorben

Werner Müller, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung und Bundeswirtschaftsminister, ist am 15. Juli 2019 gestorben.
«Ein echtes Jahrhundertwerk» habe Müller mit der RAG-Stiftung hinterlassen, würdigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den gebürtigen Essener. Die Stiftung trägt die Ewigkeitslasten der Kohleförderung, etwa das ständige Abpumpen von Grubenwasser und den Umgang mit geologischen Senkungen. Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD), unter dem Müller Bundeswirtschaftsminister war, nannte ihn «einen großen Wirtschaftslenker».
Der letzte große Ruhrbaron
Müller wurde gerne als der letzte große Ruhrbaron traditioneller Prägung beschrieben. Für einen deutschen Manager hatte Müller einen ungewöhnlichen Berufsweg. Sein Klavierstudium an der Musikhochschule in Mannheim habe ihn deutlich mehr erfüllt als die parallel belegte Volkswirtschaft, berichten Wegbegleiter.
In der Energiebranche machte dem promovierten Sprachwissenschaftler niemand so schnell etwas vor. Er arbeitete für den Stromriesen RWE und den Konkurrenten Veba, eine der Vorgängerinnen des heutigen Eon-Konzerns. Kernkraft und Kohle waren da seine Themen.
Schröder bestellte ihn nach Bonn
Müller beherrschte die feine Ironie. Etwa wenn er erzählte, wie er 1998 Bundeswirtschaftsminister wurde. Gerhard Schröder habe ihn überraschend zu Hause angerufen und nach Bonn bestellt - im Anzug. Müller war zu dem Zeitpunkt noch im Morgenmantel, schaffte es aber rechtzeitig. Auf der Autobahn habe er dann aus dem Radio den Grund der überstürzten Fahrt erfahren, erzählte Müller gerne mit leicht spöttischem Unterton. Der eigentlich für den Posten vorgesehene Quereinsteiger Jost Stollmann war kurz vor Ende der Koalitionsgespräche abgesprungen. Für die rot-grüne Bundesregierung verhandelte der parteilose Müller den ersten Anlauf zum Kohleausstieg, in dem es damals nur um den Steinkohlebergbau in NRW und im Saarland ging, nicht um die Braunkohle.
Müllers wichtigste Lebensleistung bleibt, den Bergleuten über die Stiftungslösung den Weg zum Ausstieg aus der unrentabel gewordenen Steinkohle ohne Massenproteste und dramatische Kündigungswellen gewiesen zu haben. Stattdessen wurden die Belegschaften der Zechen schrittweise und sozialverträglich mit staatlicher Förderung über viele Jahre abgebaut. Nur wenige hundert Beschäftigte bleiben dauerhaft - von mehr als 500.000 allein im Ruhrgebiet in den besten Zeiten vor Beginn der Kohlekrise Ende der 1950er Jahre.
Klavierspieler im Dreireiher
Müller war von 2003 bis 2008 Chef der Ruhrkohle AG, die sich in RAG umbenannte. Er spaltete Nicht-Kohleunternehmen aus dem bunt zusammengewürfelten RAG-Konzern ab. Die Chemiesparte formte er zur lukrativen Evonik Industries AG, deren Vorstandschef er parallel war. Aus den Einnahmen und Zinseinkünften sammelt die 2007 gegründete Stiftung Geld für die dauerhaften Lasten des Bergbaus. Die Stiftung hat schon Milliarden Euro zurückgelegt.
Bei aller Tatkraft passte Müller nicht in das Klischee eines Chefs in der harten Malocherbranche Steinkohle. Er spielte privat mit Begeisterung Klavier. Bei der Arbeit hörte er gern klassische Musik - am liebsten Bach. Müller sprach leise und wägte seine Worte genau – ein intellektueller und traditionsbewusster Querdenker im korrekten Dreiteiler, der selbst ungern Handys nutzte und Duzen im Büro ablehnte.
Eigentlich pro Atom und Kohle
Seit 2012 an der Spitze der Stiftung, wollte Müller noch lange die Kultur im Ruhrgebiet fördern - seine große Leidenschaft. Müllers Vertrag lief bis 2022. Doch schon Ende Februar vergangenen Jahres zwang ihn die schwere Erkrankung, den Rücktritt vom Stiftungs- und Evonik-Aufsichtsratsvorsitz anzukündigen.
Ein Freund eines totalen Kohleausstiegs und des Atomausstiegs war Werner Müller indes nicht: Auf der Industriepolitischen Tagung der BCE im November 2008 in Berlin etwa zitierte ihn die Industriegewerkschaft mit den Worten: Eine Energieversorgung ohne Kernenergie und Kohle ist Wunschdenken." (gedruckte ZfK 12/2008, Seite 29). Ende 2004 prognostizierte er, dass die grünen Energien in der Nische bleiben würden: "Das Ziel, den Energiebedarf 2020 zu 20 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken, halte ich allerdings für witzig, um nicht zu sagen für aberwitzig (gedruckte ZfK 1/2005, Seite 20)." Müller war auch bis 2007 Vorstandschef des Gesamtverbandes Steinkohle.
Vater der Tacke-Erlaubnis
Müller gab 2002 kurz vor seinem Ausscheiden als Bundesminister die vom Kartellamt untersagte Übernahme der Ruhrgas durch Eon frei. Da damals schon klar war, dass er zur RAG wechseln würde, die durch die Ministererlaubnis die Degussa würde übernehmen können, übergab er dieses Verfahren wegen Befangenheit seinem Staatssekretär Alfred Tacke.
Gegen Netzöffnung und KWK-Förderung
Müller war eigentlich gegen die Öffnung der Stromnetze für Drittanbieter – das Herzstück der Energiemarktöffnung –, da sie die Investitionsbereitschaft mindern würde (gedruckte ZfK 5/2004, 24). Gleichwohl bereitete er wegen des hinhaltenden Widerstands aus der Energiebranche die Gründung der Bundesnetzagentur als Regulierer vor. Sie übernahm 2003, kurz nach seinem Ausscheiden als Bundesminister, ihre Arbeit auf. Die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wurde in der rot-grünen Koalition gegen Müller durchgesetzt.
Im April 2018 erhielt Müller in der Düsseldorfer Staatskanzlei einen der höchsten Orden des Landes, der auf höchstens 2500 lebende Ordensträger begrenzt ist. Den vollen, weißen Haarschopf hatte er dabei bereits verloren, nicht aber seine distanzierte, gern auch selbstironische Art: «Ich bin etwas heftiger erkrankt», sagte er, wie immer mit leiser Stimme. «Ich hoffe, dass ich ihn (den Orden) einige Zeit tragen kann. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich den Platz in absehbarer Zeit wieder freimachen kann für andere Ordensträger.» (dpa/geo)