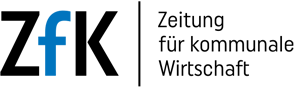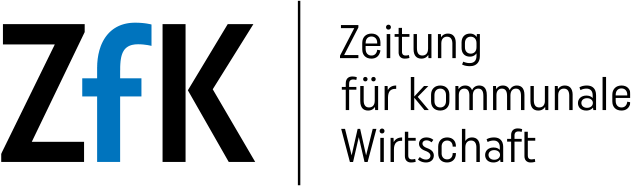VDE definiert Automatisierungsstufen für Netzbetrieb

Der VDE gibt einen Ausblick, wie die Automatisierung im Stromnetz sicher gelingen kann.
Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) schlägt fünf Autonomiestufen für einen automatisierten Netzbetrieb bis 2030 vor. Dabei läuft die Regelung von Netzkomponenten und der Redispatch schon heute teilautomatisiert.
So ist in den Leitstellen des Übertragungsnetzes bereits jetzt die Autonomiestufe 1 (Decision Support) für zahlreiche Funktionen wie etwa das Engpassmanagement als Entscheidungsunterstützung für das Systemführungspersonal möglich. Um die Reaktionsfähigkeit durch Teilautomatisierung (Autonomiestufe 2) zu erhöhen, wird dies bereits unter anderem für Schaltprogramme eingesetzt.
Teilstörungsbeseitigung und Lastabwurf teilautomatisiert
Perspektivisch empfehlen die Experten, die Teilstörungsbeseitigung und den Lastabwurf teilautomatisiert (Autonomiestufe 2) auszuführen. Für das Engpassmanagement und die Spannungs- bzw. Blindleistungskoordination empfehlen die Experten die Autonomiestufe 3.
Eine Gesamtsystemautomatisierung (Autonomiestufen 4 und 5) erwarten die Experten der Energietechnischen Gesellschaft im VDE in den nächsten zehn Jahren noch nicht.
Abhängig von Informations- und Kommunikationstechnik
In den Nieder- und Mittelspannungsortsnetzen wird die Entwicklung von der erforderlichen Prozessanbindung abhängig sein. Die VDE-Experten verweisen hier auf die Bedingungsautomatisierung, sprich Autonomiestufe 3, für verteilte Regler an Transformatoren und dezentrale Anlagen zur Spannungshaltung und zum Engpassmanagement.
„Im Nieder- und Mittelspannungsnetz ist die Automatisierungsstufe auch abhängig von der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und den Rückfallebenen für die dauerhafte Gewährleistung des sicheren Netzbetriebs“, fügt Martin Braun vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel hinzu.
Unterstützende Flexibilitäten im Verkehrs- und Wärmesektor
Für die Ortsnetze erwarten die Autoren einen höheren Grad der Automatisierung (Autonomiestufe 4) für den Normalbetrieb in regional begrenzten Teilgebieten, zum Beispiel zur Spannungshaltung, zum Engpassmanagement und für den Inselnetzbetrieb.
„In einigen Pilotprojekten zur Sektorenkopplung, wie zum Beispiel Ladeinfrastruktur 2.0, werden die Umsetzungsmöglichkeiten sowie deren Nutzen und Wirtschaftlichkeit bereits ausgelotet. Wenn diese Projekte entsprechendes Potenzial ausweisen, können unterstützende Flexibilitäten im Verkehrs- und Wärmesektor für die Stromnetze automatisiert erschlossen werden“, erklärt der Experte. (ls)