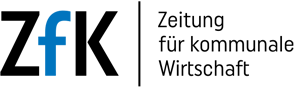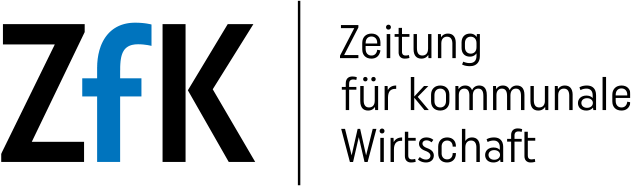Lithium aus Grubenwasser

Der Lithiumbedarf für E-Auto-Batterien könnte bis 2025 auf bis zu 30.500 Tonnen im Jahr steigen.
Bild: © Sergii/AdobeStock
Tag für Tag werden im Ruhrgebiet und an der Saar Tausende Kubikmeter Wasser aus den längst stillgelegten Bergwerken gepumpt und in Flüsse geleitet. Eine teure «Ewigkeitsaufgabe» ist das, denn die Pumpen dürfen nicht abgestellt werden, damit sich in den ehemaligen Bergbauregionen das Trinkwasser nicht mit dem belasteten Wasser aus den Kohlegruben vermischt. Rund 290 Millionen Euro hat der Bergbaukonzern RAG im vergangenen Jahr ausgegeben, um das Wasser in Schach zu halten.
Aus dem kostspieligen Problemfall Grubenwasser will Volker Presser, Professor am Leibniz-Institut für neue Materialien in Saarbrücken, einen Rohstofflieferanten machen. Denn auf seinem Weg durch die Gesteinsschichten in die alten Bergbaustollen reichert sich das Regenwasser mit vielen Mineralstoffen an, vor allem mit Natrium und Kalium. In ganz kleinen Mengen findet sich im Grubenwasser aber auch Wertvolles – unter anderem Lithium. Und das will Presser aus der Bergbaualtlast herausholen.
Komplett exportabhängig
Lithium spielt für die Elektromobilität eine entscheidende Rolle, denn das Element ist ein Kernbestandteil der Batteriezellen. Das Material wird bislang komplett importiert, vor allem aus Australien und Südamerika. «Aktuell besteht eine vollständige Importabhängigkeit der deutschen Wirtschaft, da Lithium nicht im Land gewonnen wird», betont Michael Schmidt von der Deutschen Rohstoffagentur (DERA).
Noch werden in Deutschland nur wenige Batteriezellen gefertigt. Derzeit belaufe sich die Produktionskapazität auf weit weniger als 10 Gigawattstunden, sagt Schmidt. Der Bedarf werde aber sprunghaft steigen. Der chinesische Automobilzulieferer Svolt Energy Technology will seine Europa-Produktion im Saarland ansiedeln. Tesla plant auf dem Gelände seines künftigen Werks bei Berlin in die Massenproduktion von Batteriezellen einzusteigen.
Bedarf wird stark steigen
Bis zum Jahr 2025 rechnet Rohstoffexperte Schmidt auf Basis der bisherigen Ankündigungen aus der Branche mit einer Fertigungskapazität in Deutschland von 70 bis 240 Gigawattstunden. Dann könnte der Lithiumbedarf in Deutschland nach seinen Angaben auf bis zu 30.500 Tonnen im Jahr steigen.
Einen kleinen Teil davon will Presser mit seiner Entwicklung decken. «Unser Ansatz ist, Grubenwasser als Ewigkeitschance zu verstehen und durch innovative Technologie als Wertwasser nutzbar zu machen», erläutert er. In einem Liter Grubenwasser sind zwar nur etwa 20 Milligramm Lithium enthalten. Aber in diesem Fall gilt: Die Masse macht's. Schätzungsweise 1900 Tonnen Lithium würden pro Jahr mit dem Grubenwasser weggespült, rechnet der Wissenschaftler vor. Gefördert wird sein Versuchsprojekt mit Wasser aus zwei ehemaligen Bergwerken an der Saar unter anderem von der RAG-Stiftung, die für die dauerhaften Folgekosten des Steinkohlebergbaus aufkommen muss.
Die Methode
Presser und sein Team lassen das Grubenwasser durch eine Zelle laufen, die zwei Elektroden mit unterschiedlicher Polarität enthält. Dabei bleiben Lithium- und Chlor-Ionen in der Zelle, während alle anderen gelösten Stoffe mit dem Grubenwasser wieder ablaufen. Anschließend fließt Frischwasser in die Zelle und sammelt Lithium und Chlor in Form von Lithiumchlorid ein. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt, so dass sich die Konzentration des Lithiumchlorids im Wasser immer weiter erhöht. Nach Verdunstung des Wassers liegt es schließlich in fester Form vor. Das Lithiumchlorid muss weiter aufbereitet werden, um elementares Lithium zu erhalten.
Und was kostet die Lithiumgewinnung aus Grubenwasser? Noch kann Presser das nicht sagen: «Das Projekt hat jetzt gerade begonnen – in zwei Jahren werden wir mehr über optimale Elektrodenmaterialien und Prozessparameter aussagen können.» Der Energiebedarf soll jedenfalls kostenmäßig nicht von großem Gewicht sein. Da die eingebrachte elektrische Ladung fast vollständig wiedergewonnen werde, sei das Verfahren weitgehend energieeffizient, sagt Presser.
Perspektiven für die Produktion
Lohnt sich der Aufwand für eine Lithium-Gewinnung in Deutschland? DERA-Experte Schmidt ist vorsichtig: Lithium sei kein geologisch knapper Rohstoff. «Bis 2023 beziehungsweise 2024 rechnen wir nicht mit großen Defiziten. Diese können aber ab 2025 auftreten, global und in Europa.» Wenn die Produktion in Deutschland verglichen mit dem globalen Angebot wirtschaftlich wäre, «dann kann so etwas Sinn machen».
Doch die Preisentwicklung bei Lithium ist schwer zu prognostizieren. In den vergangenen Jahren gab es heftige Ausschläge. In der Spitze habe die Tonne Lithiumkarbonat 2018 rund 19.000 Dollar (rund 15.600 Euro) gekostet, Anfang 2021 nur noch 6700 Dollar (rund 5500 Euro), berichtet Schmidt. Ab 2025 sei aber mit stark steigenden Preisen zu rechnen. Eine Chance für Lithium, gefördert oder getrocknet in Deutschland, könnte es also geben. (dpa/hp)